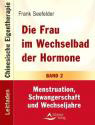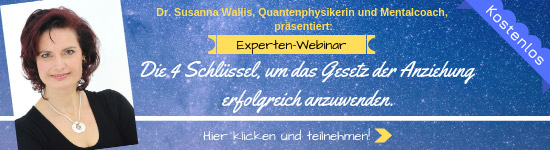Der Mensch und seine verlorene Ganzheit
von Frank Seefelder
Ganzheit ist ein natürliches Prinzip, und es ist daher jedem Menschen angeboren. In den ersten Jahren leben Kinder ihr geistiges und körperliches Gleichgewicht aus. Wenn sie sich wohl fühlen, lachen sie. Wenn sie müde sind, schlafen sie. Wenn sie zornig sind, schreien sie.
Mit ihren Reaktionen drücken sie ihre jeweilige geistige Verfassung körperlich aus. Diese Vorgänge sind ganz normal und werden von der Umwelt auch akzeptiert.
Im Kindergarten beginnt der Lebensabschnitt, in dem soziales Lernen unter Gleichaltrigen im Vordergrund steht. Die ersten Regeln beschränken die körperliche Aktivität der Kinder auf ganz bestimmte Tageszeiten.
Auch das Ausleben von Emotionen wird nur noch zu ganz bestimmten Zeiten toleriert. Wer schon einmal das scheinbar sinnlose Geschrei, das Lärmen und das Rennen während einer Kindergartenpause beobachtet hat, hat erkannt, welche geballte Energie sich in den Kindern aufgestaut hat und mit welcher Kraft sie sich entlädt.
Im späteren Leben, in der Schule, der Ausbildung, während des Studiums und auch im beruflichen Alltag ergibt sich kaum die Gelegenheit, sich auf diese Weise körperlich und geistig abzureagieren. Nur Außenseiter schreien sich ihren Frust von der Seele. Die anderen könnten zwar auch »aus der Haut fahren«, aber das widerspricht den gesellschaftlichen Konventionen.
Wer sich »in seiner Haut nicht wohlfühlt«, durchlebt den Unterschied zwischen seinen Ansprüchen und deren meist erfolgloser, praktischer Umsetzung. Die körperliche Unterforderung und die geistige Überforderung führen zum Stress. Dieser macht sich häufig durch Hautausschläge bemerkbar.
Der Lernprozess der sozialen Anpassung ist im Erwachsenenalter weitgehend abgeschlossen, und auf der Strecke bleibt die Ganzheit des Menschen. Ein Kleinkind begreift zuerst alle Dinge als Ganzes. Sieht es eine Fahrradklingel, wird es »Fahrrad« sagen und nicht »Klingel«. Bei einem Lenkrad denkt es zuerst an das Ganze, das Auto.
Dieses Ganzheitsverständnis beginnt im Kopf, und es kann durch den Ablauf des menschlichen Denkprozesses erklärt werden. Die rechte Gehirnhälfte ist für das Erleben von Gefühlen und die Entwicklung der Kreativität zuständig. In der linken Gehirnhälfte spielt sich das lineare und logische Denken ab. Erst durch die Zusammenarbeit beider Hirnhemisphären können Einzelinformationen zusammengesetzt werden.
Bei Kleinkindern ist die linke Gehirnhälfte noch nicht so weit entwickelt wie die rechte Gehirnhälfte. Die rechte Seite dominiert das Erleben und das Denken der Kinder, und so dominiert auch der Sinn für Ganzheit den Eindruck für die Einzelheit. Die Einteilung in analytische, der linken Gehirnhälfte zugeordnete, und ganzheitliche, der rechten Gehirnhälfte zugeordnete Denk- und Erfahrungsweisen gilt im Übrigen nur bei Rechtshändern. Linkshänder reagieren genau umgekehrt.
Erst durch das Zusammenspiel beider Gehirnhälften wird der Blick für die Ganzheit gewahrt. Geht dieser Überblick verloren und verschiebt sich das Gewicht stärker in Richtung Logik, so ist die logische Konsequenz, dass man »den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht«.
Die Körpersprache und die Ganzheit
Die Körpersprache ist die Form der nonverbalen Kommunikation zwischen dem Menschen und seiner Umwelt. Sie zeigt häufig die geistige Einstellung eines Menschen. Oft drücken Gesten mehr aus, als Worte sagen können, und der Körper sagt die Wahrheit, während die Worte lügen. Nicht viele Menschen sind sich darüber im Klaren, wie viele Informationen sie ungewollt an die Menschen übermitteln, die diese Sprache sprechen und Bewegungsstrukturen und Körperhaltungen deuten können.
Dies möchte ich Ihnen an zwei Beispielen aus dem Alltagsleben erläutern.
Häufig sehen Sie Menschen, die ihre Arme eng an den Körper legen oder vor der Brust verschränken. Sie signalisieren mit dieser eingeengten Position, dass sie niemandem den Platz streitig machen wollen und defensiv ausgerichtet sind. So starr und unbeweglich wie diese Körperhaltung, so unflexibel ist oft auch das Wesen der Menschen.
Sie wurden vielleicht durch Situationen geprägt, in denen sie schutzbedürftig waren, aber keinen Schutz erhalten haben. Unter Druck verkrampfen sie innerlich und äußerlich, sodass keine erneute Verletzung sie treffen kann. Unbewusst getrieben von der Angst, verletzt zu werden, schränken sich diese Menschen körperlich und auch in ihrem Sozialverhalten selbst ein. Ihre Gefühle und Gedanken behalten sie für sich, und da ihre körperlichen Entfaltungsmöglichkeiten häufig ungenutzt bleiben, verkümmern auch ihre Visionen.
Auch die innere Kreativkraft ist geballte Energie. Wird sie nicht ausgelebt oder sinnvoll kanalisiert, kann sie sich zu einer psychosomatischen Krankheit entwickeln. Eine weitverbreitete Art der Körpersprache ist das nächtliche Zähneknirschen. Ein Tier, das seine Zähne fletscht, ist aggressiv und zum Angriff bereit. Ein Mensch, der mit seinen Zähnen knirscht, handelt nach dem gleichem Schema.
Er durchlebt in der Nacht die am Tage angestauten Aggressionen. Eine weitere Form dieser psychosomatische Kausalität kann sich zum Beispiel in Schwindelanfällen zeigen. Es sind Fälle bekannt, bei denen der Schwindel immer dann auftrat, wenn die Person sich selbst beschwindeln wollte.
Ihr Frank Seefelder
Teil 1 | Teil 2
Produkte von Frank Seefelder kaufen:
versandkostenfrei in unserem Partner-Shop HORIZON