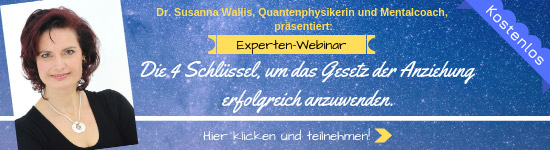Selbstverwirklichung und Holotropes Atmen
- Teil 2 -
von Dr. Sylvester Walch -
2. Selbstverwirklichung – auf dem Wege zur Ganzheit.
Um zu verdeutlichen, was ich unter Selbstverwirklichung nicht verstehe, ist es nützlich, an ein ideologiekritisches Argument zu erinnern, das in den siebziger Jahren gegen die humanistische Psychotherapiebewegung vorgebracht wurde. Ihr wurde vorgeworfen, einem maßlosen Individualismus Vorschub zu leisten, der nur das persönliche Glück im Blick habe und den gesellschaftlichen Bezug vernachlässige.
In diesem Zusammenhang wurde oft das nachfolgende Gestaltgebet von Fritz Perls, dem Begründer der Gestalttherapie, als Beleg zitiert:
„Ich lebe mein Leben und du lebst dein Leben.
Ich bin nicht auf dieser Welt, um deinen Erwartungen zu entsprechen –
und du bist nicht auf dieser Welt, um meinen Erwartungen zu entsprechen.
ICH BIN ich und DU BIST du –
und wenn wir uns zufällig treffen und finden, dann ist das schön,
wenn nicht, dann ist auch das gut so.“ (Zitat Ende)
Nur wer die eigenen Bedürfnisse spüren lernt und auch gegen den Widerstand anderer zu behaupten vermag, so könnte man es interpretieren, ist lebendig und autonom, also auf dem besten Wege zu einer reifen Identität.
In therapeutischen Prozessen steht genau diese Aufgabe im Mittelpunkt, wenn es gilt, Minderwertigkeitskomplexe, depressive Lebenseinstellungen oder Abhängigkeitsprobleme zu lösen.
Ganz unabhängig von dieser heilsamen Perspektive zeigte sich aber auch, dass die Aufforderung zu effektiver Selbstdarstellung häufig überhöht wurde und damit schroffe Abgrenzungen als Zeichen von Authentizität legitimierte.
Wer sich beispielsweise in früheren Gestaltgruppen nicht traute, sich lautstark einzubringen, blieb auf der Strecke und wurde meistens als angepasster Spießer deklassiert.
In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an folgende Szene. Ein Gruppenmitglied bat höflich darum, während der Gruppensitzung doch nicht zu rauchen . Die Raucherfraktion schmetterte diesen verständlichen Wunsch mit einem barschen „uns ist aber danach“ ab.
Damals zerbrachen auch viele Beziehungen an einem falsch verstandenen „Ich bin ich und Du bist Du“. Wenn Selbstverwirklichung zum Egotrip wird, entstehen fragmentierte Beziehungswelten, in denen die zwischenmenschliche Solidarität auf der Strecke bleibt. Das räumte sogar Laura Perls in einem persönlichen Gespräch ein, als sie das Gestaltgebet als zu wenig dialogisch anprangerte.
Da wir nicht als Einzelwesen existieren, sondern unauflöslich mit unserer Mitwelt verbunden sind, erfordert Selbstverwirklichung ein hohes Maß an Empathie- und Kooperationsfähigkeit.
Ein weiteres Problem im Umgang mit diesem Begriff besteht darin, dass in der Beschreibung „selbstverwirklichter Menschen“ häufig von einem idealisierten Endzustand ausgegangen wird. So kommt es nicht selten zu großen Enttäuschungen, wenn bei spirituellen Meistern menschliche Schwächen entdeckt werden. Ram Dass gibt unumwunden zu, dass er mit vielen Ungereimtheiten zu kämpfen hat, wenn er sagt, dass er während seines gesamten spirituellen Weges keine einzige seiner Neurosen losgeworden sei.
Der Mensch ist und bleibt unfertig, vorläufig und krisenanfällig, unabhängig von seinem Entwicklungsstand. Umgekehrt ist es aber auch möglich, dass sich die Schönheit und Vollkommenheit unseres tiefsten Wesens offenbart, ohne dass wir uns darauf vorbereitet haben. So erlebte ich Leute, die schon in ihrer ersten Atemsitzung eine kosmische Erfahrung von grenzenloser Weite und universaler Verbundenheit erlebten, obwohl sie sich davor nie mit spirituellen Themen befasst hatten.
Das bedeutet, dass wir nicht von einem rigiden, hierarchisch gegliederten, Bewusstseinsstufenmodell der Selbstverwirklichung ausgehen dürfen. In jeder Entwicklungsphase müssen je spezifische personale, transpersonale oder spirituelle Themen bewältigt werden, wenngleich sie im Einzelfall unterschiedlich gewichtet sein können. Wichtig ist, dass wir bereit sind, uns auf das einzulassen, was zum jeweiligen Zeitpunkt in Erscheinung tritt.
So gesehen gibt es keinen objektiven Status, den man als „selbstverwirklicht“ klassifizieren könnte, indes können wir in jedem Moment „selbstverwirklichend“ sein, sogar schon dann, wenn wir uns auf einfache bewusstseinsklärende Fragen einlassen, wie etwa: „Was spüre ich in meinem Innersten?“, „Welche unbewussten Motive bestimmen meine Gefühle und mein Handeln?“, oder „Welche Ängste hindern mich daran, mitfühlend zu sein?“. Auch regelmäßig zu meditieren, alltägliche Handlungen achtsam auszuführen und die Buddhanatur oder das Göttliche im anderen zu erkennen, kann uns entscheidend voranbringen. Selbstverwirklichung ist also ein Prozess, der uns zunehmend klarer vor Augen führt, wer wir eigentlich sind, was uns trägt und was im Leben wichtig ist.
Dieses Vorhaben kann jedoch nur dann dauerhaft gelingen und zu einem segensreichen Dasein führen, wenn die drei folgenden Grundlinien einer ganzheitlichen Entwicklung gleichwertig beachtet werden:
Erstens: die seelische Integration, in der wir abgespaltene und unbewusst wirkende Inhalte der Seele durcharbeiten, um einengende Lebensmuster aufzulösen.
Zum zweiten die transpersonale Transformation, die unser Bewusstsein öffnet und unter anderem auch empfänglich macht für Intuition, feinstoffliche Energiephänomene oder zeit- und raumübergreifende Informationen. Dabei erleben wir uns nicht mehr ausschließlich mit unserer Persönlichkeit identifiziert, sondern gleichzeitig mit den Welten verbunden, in denen wir leben. Im transpersonalen Bewusstsein werden wir auch gewahr, dass sich die kosmischen Zusammenhänge in uns spiegeln, die vielfältigen Erscheinungen des Seins von der Totalität des All-Einen durchdrungen sind und sich Lebendiges im Geiste des Stirb und werde erneuert.
Drittens lernen wir durch die Begegnung mit spirituellen Dimensionen, uns in einer höheren Ordnung eingebettet zu verstehen, die uns motiviert, diesem größeren Ganzen zu dienen sowie Liebe in unserem Alltag zu vermehren.
Selbstverwirklichung ist somit beständige und nie endende Bewusstseins- und Herzensarbeit, um allmählich dem wahren Kern unseres Selbst, im Einklang mit der Welt, Ausdruck zu verleihen.
Das Selbst, das wir im holotropen Atmen oft auch mit innerer Weisheit gleichsetzen, ist komplex. Einerseits gibt es uns ein Gefühl verkörperter Subjektivität, durch das wir uns, über alle Veränderungen hinweg, als von anderen unterscheidbare Person erfahren. Andererseits überschreitet es aber den begrenzten Horizont der individuellen Strukturen und verbindet uns mit dem Seinsganzen.
In diesem Sinne, kann ich mich sowohl als Sylvester, der hier einen Vortrag hält, als auch als eine, dem größeren Ganzen eingewobene, Wesensform verstehen. Wenn die subjektive Grenzziehung aufgehoben wird, verschmilzt die personale Repräsentanz mit dem universalen Seinsgrund, darin sich alles zu einem Rhythmus, zu einer Schwingung und zu einem Gleichklang fügt.
Was indes in meinem Erleben von dieser allumfassenden Wirklichkeit gegenwärtig wird, hängt von der Tiefe meiner Erfahrung, der Offenheit meines Herzens und der Beweglichkeit meines Geistes ab.
Wenn Gefühlsschwankungen oder alte Lebensmuster unsere Aufmerksamkeit zu sehr beeinträchtigen, dann können wir das Dahinterliegende und Umgreifende oft nicht mehr erspüren. So erleben wir uns manchmal als getrennt und allein gelassen, obwohl wir in der Einheit mit allem Seienden verbunden sind.
Es gilt also, Barrieren zu beseitigen, um zu realisieren, dass unser Leben einer übergeordneten Bestimmung folgt. Die im Selbst wirkenden Gestaltungskräfte sind so gebündelt und ausgerichtet, dass sich, entlang der je spezifischen persönlichen Strukturen transzendente Wirkkräfte manifestieren, die uns in geheimnisvoller Weise führen. Dazu ein Schlüsselerlebnis:
1984 leitete ich ein psychotherapeutisches Ausbildungswochenende. Gleich in der Anfangsrunde äußerte ein Teilnehmer den Wunsch, die Abendsitzung ausfallen zu lassen, um 20 km von unserem Seminarort entfernt, einen interessanten Vortrag von einem gewissen Stanislav Grof über das Holotrope Atmen besuchen zu können, einer neuen Art von Psychotherapie mit veränderten Bewusstseinszuständen.
Zunächst sträubte ich mich, weil ich seine Anregung als Widerstand gegen seinen inneren Prozess oder meine Arbeit deutete. Während ich versuchte, ihm seine unbewussten Motive klarzumachen, verspürte ich auf einmal eine irritierende Enge im Brustraum. Ich hielt kurz inne.
Spontan kam mir dann der Gedanke, dass dies vielleicht mit meinem eigenen Denkansatz oder der Interpretation dieser Situation zu tun haben könnte. Plötzlich wurde ich weicher und willigte in diesen Vorschlag ein. Damit begann für mich ein Weg, der sowohl privat als auch beruflich umwälzende Veränderungen mit sich brachte.
Gott sei Dank habe ich damals Ja gesagt!
Um einem Ruf des Schicksals folgen zu können, müssen wir aber bereit sein, unsere eigenen Vorstellungen zu relativieren. Ich bin mir sicher, dass Sie ähnliche Begebenheiten erzählen könnten. Manchmal wird das erst evident, wenn wir einen einschneidenden Lebensvorgang vom Ende her betrachten und darüber staunen, wie viele intelligente Zufälle zu diesem Ergebnis beigetragen haben.
Wenn im Wechselspiel zwischen Zulassen und eigenem Bemühen, Abspaltungen aufgehoben, verborgene Potenziale aktualisiert und subtile Energien mobilisiert werden, tritt die universale schöpferische Energie im Individuum als Tendenz zur guten Gestalt in Erscheinung.
Diese Triebfeder der menschlichen Entwicklung zeigt sich nach Maslow als Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, das jedem Menschen innewohnt. Rogers nennt es Selbstaktualisierungstendenz, Perls organismische Selbstregulation, Bergson „elan vital“, im Yoga spricht man von Kundalini und im Christentum vom heiligen Geist.
Das holotrope Atmen befreit nun diese innere Kraftquelle von Blockierungen und integriert heilende, bewusstseinserweiternde und spirituelle Prozesse in lebensfördernder Weise. So kann sich unsere Wesensnatur auf allen Ebenen verwirklichen.
Im kommenden Artikel gehe ich auf das Thema "Holotropes Atmen – eine Beschreibung" näher ein.
Herzlichst
Dr. Sylvester Walch
Mehr zum Thema Holotropes Atmen finden Sie HIER.