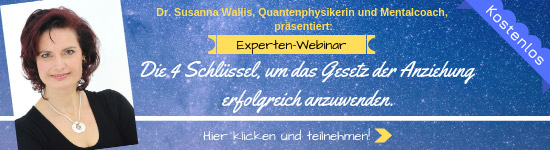Vom Ego zum Selbst - Rezension von Günther Ditzelmüller.
von Dr. Sylvester Walch -
Vom Ego zum Selbst - Rezension von Günther Ditzelmüller.
In seinem neuen Buch „Vom Ego zum Selbst“ stellt sich Sylvester Walch der schwierigen und wohl auch von zahlreichen Fallen gepflasterten Herausforderung, sich dem Thema „Spiritualität“ auf der Basis einer weitgehend psychotherapeutischen Perspektive anzunähern.
Bereits im ersten Satz der Einleitung legt sich der Autor die Latte mit der Ankündigung sehr hoch, dass er mit diesem Buch „der Entwicklung des Menschen neue Impulse geben“ möchte. Es geht ihm damit um die Überschreitung der „Alltagsgrenzen“ des individuellen Bewusstseins und um die Öffnung für ein größeres Ganzes bzw. für das „universale Selbst“.
Die von ihm propagierte und weiter entwickelte „transpersonale Psychologie“ wird damit auch als „überkonfessionelles Wachstumskonzept“ vorgestellt, das „alte Weisheitslehren des Ostens und moderne Bewusstseinsforschung mit Bedacht zusammenführt“ (S 26).
Sylvester Walch geht es in diesem Buch wohl darum, ein Herzensanliegen zu vermitteln und plausibel und schmackhaft zu machen.
Auf dem Weg zum Kern seines Buches beschäftigt sich Sylvester Walch u.a. mit erkenntnistheoretischen Fragen. Er stellt die „Erste-Person-Perspektive“ der individuellen Erfahrung - um die es in den Bereichen der Psychotherapie und der spirituellen Erfahrung geht - der „Dritte-Person-Perspektive“ der Naturwissenschaft gegenüber.
Daraus entwickelt er eine sehr differenziert ausgeführte Kritik an der quantitativen Psychologie und den reduktionistischen Tendenzen klassisch naturwissenschaftlicher Herangehensweisen - insbesondere, wenn es dabei um das Wesen des Menschen, um menschliches Verhalten und um menschliche Befindlichkeit geht.
Außerdem verweist er auf die Gefahren der weit gehenden Einschränkung menschlicher Kommunikation durch elektronische Medien und bringt mit der damit verbundenen Erhöhung der Geschwindigkeit und gleichzeitigen Einschränkung der Resonanzfähigkeit und der Selbstwahrnehmung die „Krise der Moderne“ in Verbindung.
Behutsam wendet sich Sylvester Walch dann der Diskussion persönlicher Wahrnehmungs-, Bewusstseins-, Erkenntnis- und Wachstumsprozesse zu.
Besonderen Wert legt er dabei auf die Bedeutung der Introspektion und der (körperlichen) Wahrnehmung; er plädiert dafür, inneren Impulsen vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken („das Innere, das uns stets begleitet, will wahrgenommen, gespürt und erkannt werden“; S 46).
Er entwirft dabei auch sehr bildhaft den Zugang zu psychischen Störungen und dem therapeutischen Umgang damit. Besonders bedeutsam ist für mich dabei die von Sylvester Walch kompromisslos vertretene Haltung, dass das, was ist, auch sein darf, und das Vertrauen darauf, dass sich im Laufe des Prozesses etwas Passendes und Heilsames fügt, auch wenn schwer wiegende Erfahrungen und ausweglos scheinende Situationen dagegen sprechen.
Als Hilfsmittel für die „Innenschau“ empfiehlt Sylvester Walch eine phänomenologische Haltung („das Auge muss farblos werden, um die Farbe erkennen zu können“; S 54) des vorurteilsfreien Staunens über das, was sich zeigt. Mit dem Verweis, dass diese Haltung mit dem Loslassen von Vorgefasstem verbunden ist, leitet der Autor seinen Diskurs über „Stirb und Werde“ ein.
Darin betont er, dass alles im Wandel und nichts von Dauer ist, also dauernd stirbt und wird, und dass „Transformationsprozesse“ mit einem Loslassen von Altem - quasi einem Sterben - verbunden sind.
Diese Sichtweise entspricht in gewisser Weise z.B. auch dem gestalttherapeutischen „Impasse-Konzept“, das auf eine ausweglos scheinende Situation beim Loslassen von Widerständen und „alten Konzepten“ verweist, bevor eine neue, stabilisierende Erfahrung bzw. eine Lösung zu Tage tritt.
Einen wesentlichen Teil des Buches nimmt die Einführung des „Ego“-Konzeptes und die Auseinandersetzung damit ein. Als „Ego“ versteht Sylvester Walch „unintegrierte Schattenaspekte“ (S 111) als (Persönlichkeits)eigenschaften, die abgelehnt und verdrängt und ggf. in weiterer Folge in Andere projiziert werden bzw. durch strenge Grenzen und stereotype, fixierte Verhaltensmuster vom unmittelbaren Erleben ferngehalten werden. Insbesondere nennt er narzisstische Verletzungen/Störungen als Ursache für die Ausbildung von „Ego-Komplexen“ wie Neid, den „Machtkomplex“ und die „Ohnmachtsposition“.
Die Wurzel von all dem wäre das Gefühl der Getrenntheit (S 112). Während es (u.a. mit Hilfe der Psychotherapie) das „Ich“ zu stärken und zu transzendieren und es am Wachstum des „Selbst“ zu arbeiten gälte, wäre es die Aufgabe eines an seiner spirituellen Entwicklung interessierten Menschen, das „Ego“ zu „transformieren“.
Bei diesem Verständnis von „Ego“ handelt es sich offensichtlich um neurotische Verhaltensmuster, an denen wir aus Angst festhalten, bzw. die als „Irrtümer in der Zeit“ und als überkommene Sicherheitsstrategien und Abwehrmechanismen handlungsrelevant werden.
Der Autor versteht die Einführung des „Ego“-Begriffes - abgesehen vom Sprachgebrauch in der spirituellen Literatur - als einen Versuch, einen individuell erlebbaren und wie die Begriffe „Selbst“ und „Ich“ nur schwer greifbaren Aspekt in Worte zu fassen. Das mag die Skepsis mancher LeserInnen beruhigen, die - wie ich selbst - mit dem Begriff „Ego“ einen Verweis auf persönliche „Unvollkommenheiten“ verbinden, die häufig u.a. von esoterischen Kreisen als (Schuld)zuweisungen und zur Aufrechterhaltung einer Hierarchie benutzt werden.
Sylvester Walch versucht sehr genau und vorsichtig zu differenzieren und weist auch auf die Unschärfe der Grenzen zwischen „Ich“ und „Ego“ genau so hin wie auf jene zwischen Psychotherapie und Spiritualität. Er geht auch auf die diesbezüglichen Aufgaben der Psychotherapie - v.a. „Ich“-Stärkung - und sehr genau auf pathologische Formen (z.B. Persönlichkeitsstörungen) ein und versucht die Psychotherapie von „spiritueller Begleitung“ abzugrenzen.
In der zweiten Hälfte des Buches geht Sylvester Walch auf die Bedeutung der Meditation, auf spirituelle Wege, Praktiken und fernöstlicher Begrifflichkeiten (Chakren, Kundalini...) ein.
Er verweist auch auf Gefahren und Irrwege sowie auf Gefahren durch missbrauchende oder narzisstisch besetzte („spirituelle“) BegleiterInnen. Außerdem geht er darauf ein, dass auch Menschen, die sehr tiefe Einsichten erfahren haben, nicht vor Fehlern gefeit sind und nennt Martin Heidegger und Karl Graf Dürckheim mit ihrer zumindest zeitweisen Sympathie zum Nationalsozialismus.
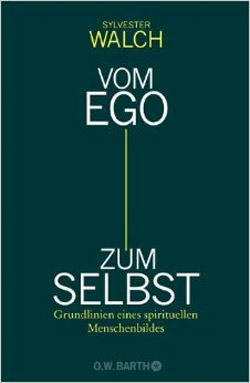 Das gesamte Buch ist durchzogen von Anweisungen zu praktischen Übungen und Phantasiereisen, die den Zugang zu den Inhalten erlebbar und so direkt erfahrbar machen.
Das gesamte Buch ist durchzogen von Anweisungen zu praktischen Übungen und Phantasiereisen, die den Zugang zu den Inhalten erlebbar und so direkt erfahrbar machen.
Ich habe dieses Buch zum einen Teil mit Neugierde und großem Interesse und zum anderen Teil mit Skepsis gelesen. Beim Lesen begegneten mir vertraute wie neue, manchmal Blickwinkel, wie auch Ansichten, die zumindest meinen Vorfassungen widersprechen und denen ich mich nur sehr vorsichtig und mit einigem Befremden nähern kann.
Begeistert bin ich von der immer wieder hinter dem Text durchscheinenden, gewährenden, integrierenden und differenzierenden Haltung und von dem reichen Fundus an jahrzehntelanger Erfahrung und unterschiedlichsten Quellen, auf die sich Sylvester Walch beruft.
Dem Autor geht es darum, Verbindungen und Grenzen zwischen Psychotherapie und spirituellen Zugängen aufzuzeigen. Er versucht damit, alte, zum Teil sehr zurecht zwischen diesen beiden Bereichen aufgerissene Gräben zu überbrücken und sie in ein neues Licht zu rücken.
Durch seine emanzipatorische, von konfessionellen und den damit häufig verbundenen moralisierenden und hierarchischen Einengungen befreite Sicht auf spirituelle Prozesse ermöglicht er auch kritischen LeserInnen eine neue Art der Auseinandersetzung mit dem schwierigen und belasteten Thema.
Gerade weil dieses Buch für mich nicht leicht verdaulich ist, weil es mich zum Nach- und Überdenken von vorgefassten Meinungen anregt, schreibe ich darüber und will zum Selberlesen animieren.
Günther Ditzelmüller
Herzlichst
Dr. Sylvester Walch