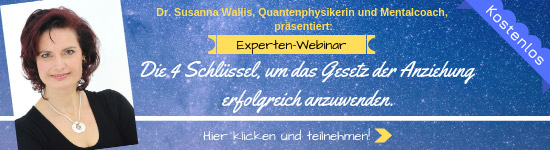Alternativen zur Psychiatrischen Behandlung.
von Oliver Steimel -
Die Seele als biologisches Konstrukt.
Immer mehr Menschen konsumieren eine immer größere Menge ärztlich verschriebener Psychopharmaka. 2010 betrugen allein die Ausgaben der AOK Rheinland/Hamburg für diesen Bereich erstmalig mehr als 100 Millionen €. Einen besonders großen Anteil an dieser Entwicklung haben Antidepressiva als Mittel für Personen mit der Diagnose Depression. Innerhalb eines Jahres von 2009 auf 2010 stieg die Anzahl dieser Patientengruppe um nicht weniger als 21,4 % (1). Die Einnahme der Medikamente wird auf Basis der jeweiligen Diagnose sämtlich von einem Teilgebiet der Medizin, nämlich der Psychiatrie angeordnet. Sie geht davon aus, dass alle seelischen Erkrankungen eine biologische Ursache haben, die im Gehirn zu finden ist. Ihre Behandlung erfolgt vor allem anhand spezieller Psychopharmaka (2). Ein Patient geht wegen psychischer Probleme zum Facharzt. Das ist noch immer der übliche Weg. Auch wenn Psyche und Seele in direkter Verbindung mit Emotionen, Affekten und dem Innenleben stehen, erklärt die Psychiatrie das gesamte Feld als rein medizinisch-biologisch. Der Psychiater schafft es dabei nach Lehrmeinung allein durch Gespräch, Fragebogen und körperliche Untersuchung, nicht nur eine passende Diagnose zu stellen, sondern auch über die geeigneten therapeutischen Maßnahmen zu entscheiden. Ein paar aufmunternde Fragen gelten bereits als psychotherapeutisch. Therapie bedeutet hier immer und hauptsächlich Psychopharmakotherapie sowie andere biologische Methoden. Psychotherapie wird als nachrangig angesehen, und nur wenige Verfahren werden von der Psychiatrie überhaupt anerkannt (3).
Die Entstehung seelischer Leiden
Der Schweizer Psychiater Luc Ciompi hält beispielsweise Schizophrenie für weit mehr als eine rein biologisch verursachte, psychische Erkrankung. Als wichtige Faktoren sieht er starken Stress, familiäre Probleme oder körperliche Belastungen. Ist ein Mensch durch seine Disposition („Verletzlichkeit“) emotional besonders dünnhäutig und damit psychosegefährdet, besteht dann eine überdurchschnittlich hohe Erkrankungsgefahr (4). Ciompi hält biologische Ursachen generell für weniger wichtig als Umwelteinflüsse. Ungelöste und schwer belastende Konflikte im persönlichen Umfeld bewertet er dabei als besonders gravierend. Dass die Schizophrenie häufig chronisch verläuft, sieht er im Zusammenhang mit einer ungeeigneten psychiatrischen Therapie, die den Krankheitsverlauf verschlimmert. Mangelnde Anregung führt zu Apathie, die psychiatrische Diagnose zu einer Stigmatisierung, welche der Patient zu Lebzeiten nicht mehr loswird. Hospitalisierung in einer psychiatrischen Anstalt begünstigt sogar wie in Gefängnissen psychischen Rückzug und Isolation. Doch der frühere Direktor der sozialpsychiatrischen Uniklinik Bern gelangt noch zu anderen bedeutsamen Schlussfolgerungen. Er stellt nicht nur die Wirksamkeit psychiatrischer Erklärungsmodelle und Therapien massiv in Frage. Er widerspricht sogar der Behauptung, es gäbe die eine, typische Schizophrenie. Im Gegenteil sei der Krankheitsverlauf mit seinen unbestreitbar schwerwiegenden Symptomen wie auch seine biographischen und sozialen Auslöser bei den Patienten sehr vielschichtig und unterschiedlich (5).
Psychopharmaka
Luc Ciompi steht auch der Vergabe psychiatrischer Medikamente kritisch gegenüber, z.B. bei seinem Projekt einer alternativen Einrichtung für Menschen in psychotischen Krisen, der „Soteria Bern“. Psychopharmaka werden auf der Grundlage verordnet, die Medizin habe die tatsächlichen Ursachen für psychische Leiden nachgewiesen. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um eine Behauptung, nämlich die, alle Gefühle und Bewusstseinsvorgänge seien nichts als Biologie und Körperchemie. Diese These wurde bis heute nicht bewiesen. Dennoch wird so getan, als seien Botenstoffe im Gehirn, die Neurotransmitter, verantwortlich für seelische Gesundheit und Krankheit. Dass Psychopharmaka heilen, ist nicht erwiesen, nur ihre dämpfende und sedierende Wirkung. Die schädlichen Folgen sind jedoch bei Neuroleptika ebenso bekannt (6) wie bei Antidepressiva. Auch die angeblich verbesserte Verträglichkeit neuerer Medikamente ist fraglich. So verursachen aktuelle Antidepressiva Kopfschmerzen, Angst, sexuelle Probleme, Aggressionen, Halluzinationen bis hin zu Selbstmordgedanken und tatsächlichem Suizid. In Großbritannien wurde das Antidepressivum Paroxetin wegen erhöhter Selbstmordgefahr für Minderjährige verboten. Prozac als weiteres, gegen Depressionen eingesetztes Mittel steht sogar in Zusammenhang mit Amokläufen an Schulen in den USA (7). Neuroleptika sind das heutige Standardmittel bei Psychosen, die nicht antidepressiv behandelt werden. Diese atypisch genannten Medikamente sollen deutlich verträglicher sein. Sie würden kaum noch zu den typischen Muskel- und Bewegungsstörungen der früheren Präparate führen und sich positiv auf den sozialen Rückzug der Patienten auswirken. In der Tat enthalten diese neueren Neuroleptika keine verbesserten Wirkstoffe, sondern führen lediglich zu einer besseren Unterdrückung z.B. von Parkinsonismus, wie er bei den typischen Neuroleptika noch üblich war. Es wird also lediglich ein Symptom kontrolliert, das sowieso nur durch die Medikamente verursacht worden war. Wie Gerhard Ebner, Präsident der Schweizerischen Vereinigung Psychiatrischer Chefärzte erklärt, liegt der Effekt der neueren Neuroleptika nicht in der Abnahme der so genannten Nebenwirkungen. Durch die moderne Zusammensetzung der Inhaltsstoffe treten lediglich andere schädliche Wirkungen auf, die zudem für den Patienten noch schwieriger wahrnehmbar sind, ihn aber gerade dadurch eher dazu bringen sollen, die verschriebenen Psychopharmaka einzunehmen. Die Wirkungen der modernen Neuroleptika sind in der Öffentlichkeit bekannt. Sie umfassen Fettleibigkeit, Diabetes, beschleunigte Alterung und erhöhte Sterblichkeit (08). Von größerer Verträglichkeit oder gar Heilkraft kann also keine Rede sein.
Alternative Behandlungsformen
Wenn psychische und seelische Leiden mit einer Vielzahl von Faktoren, Biographie, körperlichem Zustand, Stress und Konflikten in Verbindung stehen, wie könnte dem eine primär biologisch ausgerichtete Wissenschaft gerecht werden? Angesichts potentiell schädlicher Psychopharmaka und psychiatrischer Behandlung stellt sich die Frage, ob Psychiatrie wirklich heilsam sein kann. Wie soll das möglich sein durch rein chemische Substanzen, diagnostische Betonung kaum heilbarer Krankhaftigkeit und im Kontext dieses Menschenbildes wieder in Mode kommender Elektroschocktherapie? Auch in der Heilung seelischer Leiden muss die Komplexität der Person und ihres Umfeldes angemessene Berücksichtigung finden. Zu diesen alternativen Behandlungsformen gehören verschiedene psychotherapeutische Methoden ebenso wie Selbsthilfe und Begleitung von Angehörigen, psychische Reflexion und körperliche Aktivitäten wie z.B. Laufen (9). Natürlich bedürfen starke psychische Störungen, gerade wenn sie mit Selbstmordgefahr einhergehen, umfassender Hilfe und können nicht einfach „weggejoggt“ werden. Noch wenig bekannt ist aber, dass bei entsprechender fachlicher Begleitung statt herkömmlicher Psychopharmaka z.B. bestimmte homöopathische Mittel auch bei schweren Psychosen eingesetzt werden können (10). Akzeptiere ich das diagnostische Urteil eines Psychiaters, kann ich damit sicher wenig anfangen. Dennoch wirkt psychiatrische Behandlung mehr dämpfend als heilend. Wenn der Mensch sich aber seine eigene Verletzlichkeit ein- und zugesteht, eröffnen sich ihm andere Möglichkeiten der Heilung.
(1) Psychologienachrichten.de, „2010 stieg die Zahl der verordneten Psychopharmaka weiter an“, 04.05.2011
(2) de wikipedia.org/wiki/Psychiatrie
(3) „Psychiatrie und Psychotherapie“, H.J. Möller, G. Laux, A. Deister, Thieme-Verlag, 2005
(4) www ciompi.com/de/schizophrenie.html
(5) „Zementiertes Leiden“, Der Spiegel 33 / 1980
(6) „Psychiatrie- ihre Diagnostik, ihre Therapien, ihre Macht“, Marc Rufer in „Statt Psychiatrie 2“, S. 400ff, Antipsychiatrieverlag, 2008
(7) „Der niedergeschlagene Mensch“, S. 106, Charlotte Jurk, Verlag Westfälisches Dampfboot, 2008
(08) „Atypische Neuroleptika- immer teurer, immer besser?“, Peter Lehmann in „pflegen: psychosozial – Zeitschrift für professionelle psychiatrische Arbeit“, 2010
(9) „Statt Psychiatrie 2“, s.o.
(10) www homoeopathie-homoeopathisch.de/psyche/psychopharmaka.shtml